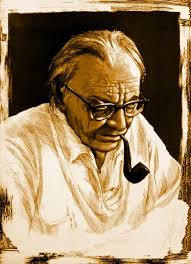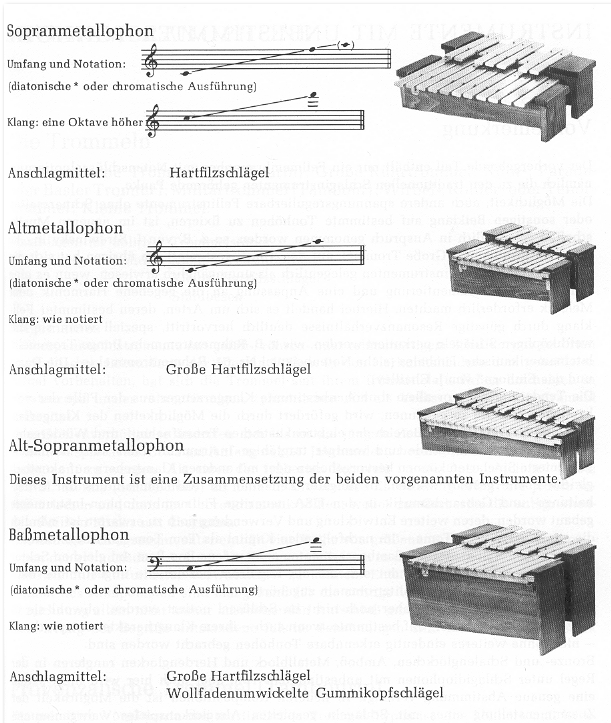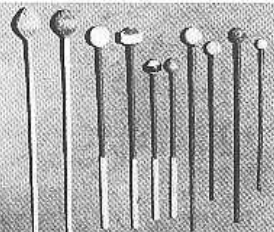Die ORFF-Instrumente
falls
sie lieber ausgedruckte Texte lesen, finden sie
HIER
eine pdf-Version von Rubrik GM
C
EINFÜHRUNGSVIDEO "Orff-Instrumentarium" von Pius Haefliger
Neu ab Studienjahr 2017/18 stelle ich
meinen Gruppenmusizier-Studierenden ein Einführungsvideo zum Thema
Orff-Instrumente zur Verfügung.
Der Sinn dieses Videos ist, bereits beim
Start des Unterrichts zu wissen,
-
wieso diese Instrumente
Orff-Instrumente heissen
-
welches ihre Vorzüge sind
-
welche verschiedenen Grössen von
Orff-Stabspielen es gibt
-
welche Schlägel man verwendet
-
welche Begleitformen (deren 4) wir im
Unterricht anwenden werden
Wenn Sie also in die erste Veranstaltung
kommen, wissen Sie bereits über die oben aufgeführten Punkte
Bescheid, d.h. wir können direkt mir dem Musizieren starten.
Vorteil: es bleibt mehr Zeit fürs aktive Musizieren!
Das Video ist Voraussetzung für
einen erfolgreichen Unterrichtsstart. Anstatt all diese
Dinge im Unterricht zu erzählen, lasse ich Sie diese zu Hause in
Ruhe anschauen. Es macht Sinn, das Video sofort nach Erhalt
zu schauen sowie -ein zweites Mal- kurz vor Beginn des
Unterrichts. Allfällige Fragen, die Sie zum Video haben, können
Sie gerne im Unterricht stellen.
Video im "*.avi"-Format (590 MB)
Video im "*.wmv"-Format (412 MB)
Video im "*.mp4-Format (461 MB)
>HOME<
Carl Orff
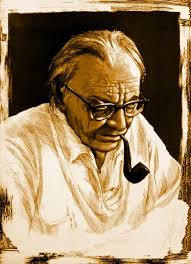
(* 10. Juli 1895 in München; † 29. März 1982 in
München)
Carl
Orff erhielt ab 1900 Klavier-, Cello- und Orgelunterricht. In
diesem Jahr erschien auch seine erste Komposition. Frühe Erfahrung
im Musizieren in der Gruppe sammelte er als Schüler des
Wittelsbacher-Gymnasiums, wo er das Schulorchester auf der Orgel,
dem Klavier oder Harmonium begleitete und im Schulchor Solopartien
als Sopran übernahm. Außerdem sang er sonntags im Kirchenchor, und
zuhause, von seiner Mutter am Klavier begleitet, Opernpartien nach
Klavierauszügen. Mit 14 Jahren war er nach dem Besuch der Oper Der
Fliegende Holländer von Richard Wagner tagelang so erregt, dass er
diese bald darauf mit einem Klavierauszug ausgestattet erneut
besuchen musste, um wieder ansprechbar zu werden.
Nachdem Carl
Orff 1911 unter
anderem Gedichte von Hölderlin und Heine für Gesang und Klavier
vertont hatte, studierte er von 1913 bis 1914 an der Königlichen
Akademie der Tonkunst in München und widmete sich daneben der
Musikpädagogik. Nach kurzem Kriegsdienst (1914) war er bis 1919
Kapellmeister in München, Mannheim und Darmstadt. Carl Orff
studierte 1921 und 1922 in München bei Heinrich Kaminski. 1924
gründete er gemeinsam mit Dorothee Günther die Güntherschule
München - Ausbildungsstätte vom Bund für freie und angewandte
Bewegung e.V., die in den Bereichen Gymnastik, Rhythmik, Musik und
Tanz ausbildete. Carl Orff selbst übernahm an der Güntherschule
die Leitung der Musikabteilung. Grundlage seiner Arbeit bildete
die Idee, das musikalisch-rhythmische Gefühl aus der Bewegung
heraus zu entwickeln. Aus dieser Idee entwickelte er gemeinsam mit
seiner Mitarbeiterin Gunild Keetman ein neues Modell für Musik-
und Bewegungserziehung: das Orff-Schulwerk. Erste
Veröffentlichungen hierzu erfolgten zwischen 1930 und 1934.
Mit Gunild Keetman gab er von 1950 bis 1954 fünf Bände Musik für
Kinder heraus (Neufassung des Orff-Schulwerks). Die Kinder sollten
durch eine musikalische Erziehung auch zu sich selbst finden. So
werden seine Lehren auch in der Heilpädagogik bis heute
eingesetzt. Sein bekanntestes Werk wurden die Carmina Burana, ein
Musikstück, das 24 Texte aus der mittelalterlichen Handschrift
Carmina Burana neu vertonte. Auf literarische Vorlagen
(insbesondere von Aischylos, Catull, Friedrich Hölderlin und den
Brüdern Grimm) griff er auch bei anderen Werken zurück.
Neben seiner kompositorischen Arbeit übernahm er auch
Führungspositionen in verschiedenen musikalischen Einrichtungen.
Er war von 1950 bis 1960 Leiter einer Meisterklasse an der
Musikhochschule in München. 1961 folgte die Leitung des
Orff-Instituts in Salzburg. Orff erhielt zahlreiche
Auszeichnungen: Ehrendoktor wurde er in München und Tübingen, das
Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhielt er
1972. 1974 wurde Orff mit dem Romano-Guardini-Preis ausgezeichnet.
Ab 1962 war Wilhelm Keller Leiter des Orff-Instituts in
Salzburg. Zusammen mit dem niederländischen Musiker und
Musikpädagogen Pierre van Hauwe gehört er zu den größten Förderern
des Orffschen Schulwerkes in Europa.
Carl Orff war viermal verheiratet, darunter von 1939 bis
1953 in zweiter Ehe mit der Musik-Therapeutin Gertrud Orff und von
1954 bis 1959 in dritter Ehe mit der Schriftstellerin und
Pädagogin Luise Rinser. Orff hatte
eine Tochter aus erster Ehe,
die Schauspielerin Godela Orff (* 1921).
Das Raffinierte am
ORFF-Stabspiel
Die Grossen Varianten des orffschen Xylophons und des Metallophons
gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Es handelt sich um das
Orchesterxylophon

und um das
Vibraphon

Gewöhnlich sind alle Klangstäbe eines Xylophons oder eines
Vibraphons mit zwei Schnüren zusammengebunden. (Prinzip
«Strickleiter») Dies hat zur Folge, dass man die Klangstäbe nicht
einzeln herausnehmen kann, sondern bloss alle gleichzeitig.
Carl Orff hat die Instrumente so umbauen lassen, dass jeder
Klangstab auf ein oder zwei Zapfen aufliegt und einzeln entfernt
werden kann.
Das hat für die Kinder den Vorteil, dass bloss jene Stäbe auf dem
Instrument liegen müssen, die das Kind wirklich braucht; die
andern nimmt man weg. So kann sich das Kind besser orientieren.
Beispiel: Soll das Kind einen C-Dur-Dreiklang spielen, so nimmt
man die Töne D, F und A weg. Was bleibt, sind jene Stäbe, welche
zusammen den C-Dur-Dreilang bilden.
Orff-Instrumente
Das Orff-Instrumentarium setzt sich
aus zwei Instrumenten-Typen zusammen:
- Die ORFF-Stabspiele
- Die ORFF-Rhythmusinstrumente
ORFF-Stabspiele
Die Orff-Stabspiele werden unterteilt in
Xylophone und Metallophone;
also in Instrumente mit Holzklangstäben und in Instrumente mit
Metallklangstäben
Xylophon (griechisch xylon: Holz und phoné: Klang,
Stimme):
Schlaginstrument, das aus einer Reihe abgestimmter
Holzstäbe besteht, die mit löffelartigen Holzklöppeln angeschlagen
werden. Xylophone wurden schon im 14. Jahrhundert in Südostasien
gebaut. Das Instrument wurde vermutlich über Madagaskar nach
Afrika eingeführt, wo es sich bald über den ganzen Kontinent
ausbreitete und zu einem Hauptinstrument der traditionellen Musik
wurde. Afrikanische Sklaven brachten das Xylophon nach Südamerika,
wo es heute als Marimba (oder unter einem der vielen anderen
afrikanischen Namen) bekannt ist. Um 1500 gelangte das Xylophon
nach Europa, wo es Eingang in die Volksmusik fand. Seit dem späten
19. Jahrhundert wird das Xylophon verstärkt in der abendländischen
Kunstmusik verwendet. Im Danse Macabre (1874) des französischen
Komponisten Camille Saint-Saëns wurde das Xylophon erstmals im
Symphonieorchester eingesetzt. Igor Strawinsky verwendete es in
seinem Werk Petruschka (1911).
Das einfache afrikanische
Xylophon besteht aus einer Doppelreihe von Holzstäben, wobei die
Stäbe an einem Rahmen befestigt sind und an nichtschwingenden
Punkten auf dem Rahmen aufliegen. Beim Spielen ruht das Instrument
gewöhnlich auf den Oberschenkeln. Meist befinden sich
Resonanzröhren unter dem Rahmen (wie bei der kongolesischen
Kalanba, die Flaschenkürbisse als Resonatoren hat), oder der
Rahmen selbst bildet einen trogartigen Resonanzkörper (wie bei dem
indonesischen Gambang). Das Orchesterxylophon hat zwei Stabreihen,
die wie eine Klaviatur angeordnet sind. In der Regel befindet sich
unter jedem Stab eine Resonanzröhre. Dieses Instrument wird mit
zwei harten Klöppeln gespielt, die den charakteristischen
trockenen, durchdringenden Klang erzeugen, oder mit vier bis acht
weicheren Gummischlegeln für Akkorde. Der Tonumfang beträgt meist
vier Oktaven, angefangen beim eingestrichenen C. Die
Orchestermarimba hat ebenfalls Röhrenresonatoren, ist aber eine
Oktave tiefer gestimmt als das Xylophon.
Xylophonähnliche
Instrumente mit Metallstäben heißen Metallophone. Zu dieser Gruppe
gehören das Glockenspiel, das Vibraphon und verschiedene
Instrumente, die im indonesischen Gamelan-Orchester verwendet
werden.
Die Verwendung des
Xylophons im Unterricht
Da das Klangmedium beim
Xylophon Holz ist, klingt das Instrument entsprechend trocken; der
einzelne Ton hat sozusagen keinen Nachhall. Das heisst, es eignet
sich besser für schnelle Rhythmen mit kurzen Notenwerten. Wie bei
den Metallophonen kann jeder einzelne Stab des Instrumentes
entfernt werden. Dies wissen zwar viele Lehrpersonen. - im
Ernstfall wenden sie aber dieses Wissen trotzdem nicht an. Die
Folge davon: Das Kind muss sich in der Fülle von Stäben
zurechtfinden, was besonders in der Unterstufe sehr schnell zu
einem Problem wird (Noten lesen, Buchstaben lesen - -). Das
Herausnehmen der nicht benötigten Stäbe hat zudem den Vorteil,
dass das Kind beim Spielen nicht so treffsicher sein muss - die
Chance, falsche Töne zu treffen, nimmt ab. Achtung: Nicht jedes
Xylophon hat den gleichen Tonumfang: Es lohnt sich sehr, anfang
Jahr einmal in den Singsaal oder ins Musikzimmer des Schulhauses
zu gehen und sich die Tonumfänge der Orff-Stabspiele
aufzuschreiben.
Dazu kommt noch, dass natürlich auch die
Xylophone in verschiedenen Stimmungen (Grössen) gebaut werden. So
gibt es Sopranxylophone, Alt-, Tenor- und Bassxylophone. Das oben
gesagte betreffs trockenem Klang gilt natürlich am ehesten für die
hoch gestimmten Instrumente (weil ihre Stäbe kürzer und dünner
sind). Ein Bass-Xylophon kann hingegen ohne weiteres für lange
Bordun-Quinten verwendet werden.
Wenn das Kind vor dem
Xylophon steht, sind die tiefen Töne links und die hohen rechts -
wie beim Klavier-. Da die Schulxylophone in aller Regel nicht
chromatisch gestimmt sind, lässt es sich ohne weiteres
arrangieren, dass das Instrument von beiden Seiten "bespielt"
wird. Das heisst: Ein Kind steht "richtig" vor dem Instrument, das
andere Kind hingegen "seitenverkehrt". Das "richtige" hat die
tiefen Stäbe links, das "seitenverkehrte" hat sie rechts. So lässt
sich unter anderem vermeiden, dass sich die Kinder ständig im Weg
stehen.
In meiner Vorlage für Orff-Sätze würde ich das
Xylophon am ehesten in den Stimmen "Terzen-Begleit" und
"Rhythmischer Grundtonbegleit" einsetzen.
Verwendung der richtigen Schlägel
Das Instrument
klingt nur dann richtig, wenn die richtigen Schlägel verwendet
werden. Die Grundregel lautet: Kleines Instrument - kleine, eher
harte Schlägelköpfe / grosses Instrument - grosse, weiche
Schlägelköpfe

Metallophon
Jene Untergruppe der Orff-Instrumente,
welche als Klangmedium die Metallplatte verwenden; zu ihnen gehört
demnach auch das Glockenspiel.
Sie eignen sich in der
Orff-Begleitpartitur vorallem für lange Noten (also zum Beispiel
für einen aus langen Tönen bestehenden Grundtonbegleit), da die
Metallplatten viel länger ausklingen als zum Beispiel die (Holz-)
stäbe des Xylophons.
Die höchste Variante des Metallophons
ist das sogenannte "GLOCKENSPIEL", welches 1 oder sogar 2 Oktaven
höher klingt als notiert.
Eine in der Schule sehr
gebräuchliche Variante des Metallophons ist das Alt-Metallophon:
Es ist ungefähr vergleichbar mit der Tonlage des Alt-Xylophons.
Eine sehr spezielle Art des Metallophons ist das "Vibraphon".
Bei ihm gehört zu jedem Ton (Metallplatte) eine Resonanzröhre, in
welcher (mit elektrischem Antrieb) ein Vibrato (ein Schwingen des
Tones) erzeugt wird.
Der Motor des Vibraphons kann verschieden
schnell eingestellt werden; das Tempo des Vibratos kann sich somit
verändern.
Die Verwendung der
Metallophone im Unterricht
Da das Klangmedium beim
Metallophon eben Metall ist, hat jeder einzelne Ton einen
entsprechend langen Nachhall. Das heisst, es eignet sich besser
für lange Notenwerte. Wie bei den Xylophonen kann jeder einzelne
Stab des Instrumentes entfernt werden. Dies wissen zwar viele
Lehrpersonen - im Ernstfall wenden sie aber dieses Wissen trotzdem
nicht an. Die Folge davon: Das Kind muss sich in der Fülle von
Stäben zurechtfinden, was besonders in der Unterstufe sehr schnell
zu einem Problem wird (Noten lesen, Buchstaben lesen - -). Das
Herausnehmen der nicht benötigten Stäbe hat zudem den Vorteil,
dass das Kind beim Spielen nicht so treffsicher sein muss - die
Chance, falsche Töne zu treffen, nimmt ab. Achtung: Nicht jedes
Metallophon hat den gleichen Tonumfang: Es lohnt sich sehr, anfang
Jahr einmal in den Singsaal oder ins Musikzimmer des Schulhauses
zu gehen und sich die Tonumfänge der Orff-Stabspiele
aufzuschreiben.
Dazu kommt noch, dass natürlich auch die
Metallophone in verschiedenen Stimmungen (Grössen) gebaut werden.
So gibt es Sopranmetallophone (genannt Glockenspiel), Alt-, Tenor-
und Bassmetallophone. Je tiefer das Instrument, desto länger der
Nachhall des einzelnen Tones und desto voller der Klang.
Wenn das Kind vor dem Metallophon steht, sind die tiefen Töne
links und die hohen rechts - wie beim Klavier-. Da die
Schulmetallophone in der Regel nicht chromatisch gestimmt sind,
lässt es sich ohne weiteres arrangieren, dass das Instrument von
beiden Seiten "bespielt" wird. Das heisst: Ein Kind steht
"richtig" vor dem Instrument, das andere Kind hingegen
"seitenverkehrt". Das "richtige" hat die tiefen Stäbe links, das
"seitenverkehrte" hat sie rechts. So lässt sich unter anderem
vermeiden, dass sich die Kinder ständig im Weg stehen.
In
meiner Vorlage für Orff-Sätze würde ich das Metallophon am ehesten
in den Stimmen "Bordun-Quinte" und "Grundtonbegleit" einsetzen.
Verwendung der richtigen Schlägel:
Das Instrument klingt nur dann richtig, wenn die
richtigen Schlägel verwendet werden. Die Grundregel lautet:
Kleines Instrument - kleine, eher harte Schlägelköpfe / grosses
Instrument - grosse, weiche(re) Schlägelköpfe
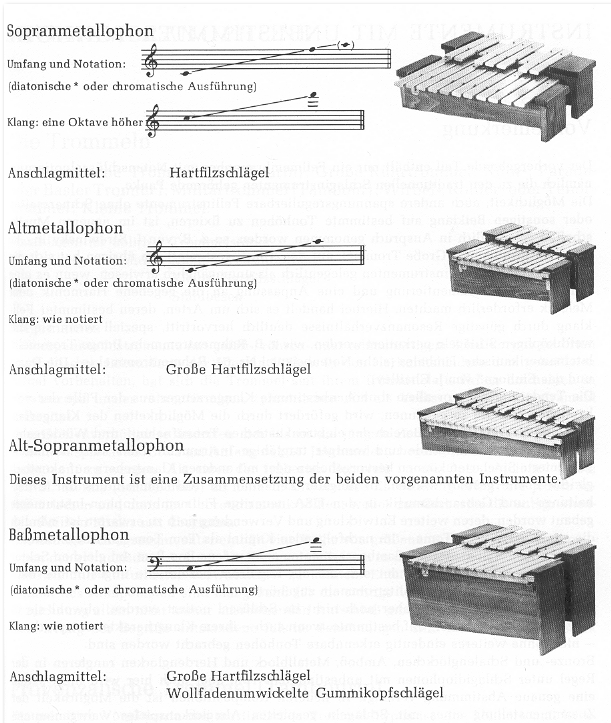
Glockenspiel
Das Glockenspiel existiert ebenfalls in
verschiedenen Grössen. Glockenspiele sind die am höchsten
klingenden Metallophone. Das Typische an den Glockenspielen ist
das Glänzen/Reflektieren der Metallklangstäbe.

Verwendung der richtigen Schlägel:
Das Instrument klingt nur dann richtig, wenn die
richtigen Schlägel verwendet werden. Da die Metallklangstäbe des
Glockenspiels eine viel kleinere Mensur haben als diejenigen eines
mittelgrossen Metallophons, muss der Schlägelkopf entsprechend
klein sein. Am Geeignetsten ist ein kleiner, gummiüberzogener
(relativ harter) Schlägel.
Schlägelwahl
Nicht jedes Orff-Stabspiel verlangt den
gleichen Schlägel (oder das gleiche Schlägelpaar)!
Die
Regel ist die, dass ein tiefklingendes Instrument einen eher
grossen, weichen Schlägel benötigt, weil die Klangstäbe des
grossen Instruments mehr Masse besitzen und folgedessen
schwieriger in Schwingung zu versetzen sind. Demgegenüber benötigt
ein Glockenspiel einen Schlägel mit kleinem, eher hartem Kopf; ein
Schlägel mit weichem Kopf würde den (Metall!)-Klangstab gar nicht
erst richtig in Schwingung versetzen, das Instrument würde "dumpf"
klingen!
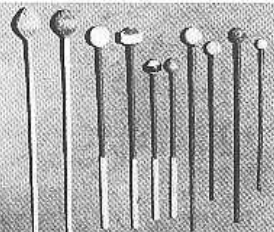
ORFF-Rhythmusinstrumente
Diese lassen sich am besten
zeigen, indem wir verschiedene Orff-Ausrüstungen -eine
Grundausrüstung sowie eine erweiterte Ausrüstung - einander
gegenüberstellen
Das ORFF'sche
Grund-Instrumentarium
Dies ist in etwa das, was wir häufig in
Singsälen von Schulhäusern antreffen: Eine eher geringe Anzahl
ORFF'sche Stabspiele und eine eher grössere Anzahl
Schlaginstrumente, wie sie zum Orff-Instrumentarium dazugehören.
Es ist allerdings zu erwähnen, dass diese Schlaginstrumente in der
Musik allgemein gebräuchlich sind, also nicht etwa von Carl Orff
"erfunden" wurden.

Legende:
- Alt-Xylophon diatonisch
- Alt-Metallophon diatonisch
- Bongo
- Sopran-Xylophon diatonisch
- Alt-Glockenspiel diatonisch
- Rahmentrommel und Rahmenschellentrommel
- Schellenband
- Triangel
- Schellenkranz
- Maracas-Kugeln
- Becken
- Besen
- Schlägel für Stabspiel (Filz)
- Cymbeln
- Fingerzymbeln
- Holzblocktrommel
- Wooden Agogo
- Schlagstäbe
Das erweiterte ORFF'sche Instrumentarium
sieht so aus:

- Drehpauke hoch
- Drehpauke tief
- (Tenor)Bass-Xyophon
- (Sopran)Glockenspiel
- Metall-Shaker
- Schellenring
- Guiro
- Tischkastagnette
- Vibraslap
- Schlagstäbe / Schlaghölzer
Die
Tonumfänge der Orff-Stabspiele
Nicht alle Orff-Xyophone und -Metallophone
haben denselben Tonumfang!
Wenn im Schulhaus verschieden hoch
gestimmte Instrumente vorhanden sind, lässt sich ein regelrechtes
ORFF-Orchester zusammenstellen.
Hier finden sie
eine Tabelle zu den Tonumfängen von Stabspielen und
Rhythmusinstrumenten
>
Die Qualität von Orff-Stabspielen
ORFF-Stabspiele sind teuer....
Ein gutes (chromatisches) Xylophon kostet
schnell mal 1'300-1'600 Franken.
Es gibt gute und schlechte
Orff-Stabspiele; sie zu unterscheiden, ist relativ einfach.
Die schlechten Instrumente haben
Gummizapfen, auf denen die Klangstäbe fixiert werden. Nimmt nun
das Kind oder die Lehrperson den Klangstab weg, so löst sich schon
nach kurzer Zeit der Gummiüberzug des Metallstiftes, welcher den
Klangstab stabilisiert. Ist der Gummiüberzug dann mal weg, kann
man den Klangstab nicht mehr richtig auf die Halterung stecken;
die Folge: der Klangstab klingt sehr dumpf oder überhaut nicht
mehr...
Die guten Stabspiele sind anders gebaut:
Sie haben bloss am einen Ende des
Klangstabes ein Loch. Der Klangstab wird draufgelegt, ohne ihn
wirklich zu fixieren. Die Folge ist, dass die Halterung nie
beschädigt wird. Solche Instrumente halten "ewig"